«Denn alles, was macht braucht, zum Leben und zum Schreiben, sind Liebe und Erfahrungen.»
Aus: Kein Seeweg nach Indien
Eduschka - 7. Dez, 16:53
Wie sehr es uns doch schmeichelt, wenn uns ein Büsi flattierend um die Beine streicht. Oder wenn wir beim Heimkommen bereits an der Türschwelle von unserem Hund abgeholt werden, der freudig mit dem Schwanz wedelt und uns lautstark Willkommen heisst. Hund und Katze sind die Lieblings-Haustiere der Nation. Nutztiere im engen Sinne sind sie zwar nicht, und doch erweisen sie dem Menschen einen wertvollen Dienst: Sie spenden Trost und füllen leere oder leer gewordene Stellen im Innern auf. Sie sind emotionaler Kitt für geschundene Seelen. Warum sonst würde man in psychiatrischen Institutionen Katzen halten? Ein Tier schenkt Nähe; eine sehr einfache Nähe, weil sie äusserst berechenbar ist. Sie wird bestimmt vom Rhythmus des tierischen Urbedürfnisses: Seinem Hunger, seinem Durst, seinem Bewegungsdrang. Ein Tier gibt unmissverständlich zu verstehen, was es gerade braucht. Es druckst nicht herum, schämt sich nicht und redet auch nicht um den heissen Brei. Das macht Tiere nach unserer Auffassung so ehrlich.
Haustiere decken das emotionale Grundbedürfnis des Menschen nach Nähe und Geborgenheit ab. Oftmals schaffen sich Menschen in einer besonders krisengeschüttelten Lebensphase ein Hund oder eine Katze an. Und doch unterscheiden sich Hund und Katze ganz grundsätzlich in ihren «Funktionen»: Eine Katze ist verschmust, aber nur, wenn es ihr passt. Sie flattiert ein bisschen, frisst und geht dann wieder ihre eigenen Wege. Eine Katze kann man unmöglich zähmen. Anders der Hund: Man muss ihn zähmen, man muss ihn «erziehen», und ist das einmal geschafft, wird der Hundehalter mit einer Loyalität belohnt, die seinesgleichen sucht. Je nach Rasse ist auch ein Hund verschmust, doch anders als die Katze ist er es zu jeder Zeit, ohne Ausnahme. Die Partnerschaft zu seinem Herrchen steht bei ihm über allem, sie ist eng, fast schon symbiotisch.
Verlassene Männer oder solche, die von Mitmenschen enttäuscht wurden und eine dicke Mauer als Schutzwall um sich errichtet haben, sind besonders geneigt, sich einen Hund – meistens ein Schäfer – anzuschaffen. «Nimm Dich von einem alleinstehenden Mann mit Hund in Acht», heisst es daher unter Freundinnen. Denn ein solcher Mann sehnt sich nach echter Kameradschaft, und mit einem Schäfer trägt er seinem Bedürfnis nach Nähe Rechnung. Im Gegensatz zur Partnerschaft mit einer Frau ist eine Kameradschaft mit einem Hund jedoch viel sicherer, denn seine Liebessprache ist unmissverständlich. Er schenkt Zuneigung, ohne mehr als Futter zu verlangen, er ist ein wahrer Kamerad. Die Bedürfnisse beider Seiten werden rasch belohnt. Es gibt keine Stadien, keine Prozesse wie bei menschlichen Beziehungen. Es gibt kein Davor, Dahinter und Dazwischen. Keine Schattierungen, keine Grautöne. In diesem Extrem-Stadium ist es diesem Typ Mann nicht mehr möglich, Nähe zu einer Frau zuzulassen. Weil eine Beziehung bedeuten würde, die Kontrolle über seine Gefühle zumindest teilweise aus der Hand zu geben. Doch ein Hunde-Mann braucht diese Kontrolle. Er will sagen können: «Sitz!», und der Hund macht Sitz.
Solche Männer tragen einen Teil in sich, der abzusterben droht. Dieser Teil heisst «Lebendigkeit». Sie nutzen nicht die ganze Klaviatur ihrer emotionalen Möglichkeiten. Es ist ein bisschen so, als würden sie immer nur auf den weissen Tasten des Klaviers spielen. Es entsteht zwar eine Melodie, aber sie ist weit unter den Möglichkeiten, die das Klavier zu bieten hat. Eine richtig schöne Melodie – ihre ganz eigene Melodie – kann eben nur entstehen, wenn sie die Möglichkeiten des Klaviers voll ausnutzten und versuchen, auch auf den schwarzen Tasten zu spielen.
Eduschka - 7. Dez, 16:35
Auf europäischen Weltkarten befindet sich Europa im Zentrum der Karte. Betrachtet man eine amerikanische Weltkarte, ist der amerikanische Kontinent in der Kartenmitte. Das Zentrum unserer Welt scheint also eine Frage des Standpunkts zu sein, auf internationalen Kartografen-Tagungen aushandelbar wie die Relevanz des Reliefs. Was würde nun geschehen, wenn wir für die Dauer eines Lidschlags Indien ins Zentrum der Karte, und damit ins Zentrum der Welt setzen würden?
In einem Punkt sind sich die Kartografen schnell einig: Indien lässt sich kaum mit westlichen Massstäben messen. Die Bedingungen, denen das Land unterworfen ist − die riesige Ausdehnung, die Überbevölkerung, das Klima − sind so extrem, dass sich Indien eigentlich nur anhand seiner eigenen Massstäbe messen lässt. Besucher aus dem Westen zeigen sich oftmals schockiert über den chaotischen Verkehr. Doch für Indien ist nicht von Belang, wie gut der Verkehr fliesst, für Indien ist einzig entscheidend, dass er fliesst. Indien ist, um auf Gerichtssprache zurückzugreifen, in jeder nur erdenklichen Hinsicht ein Präzedenzfall.
In den letzten Jahren hat Indien einen regelrechten Boom erlebt, die Wachstumsraten sprengen die kühnsten Erwartungen, der Mittelstand wächst, der Kontrast zwischen alt und neu ist bemerkenswert, ebenso wie die die Kluft zwischen Arm und Reich. Doch auch im modernen Indien hat sich eines nicht geändert. Indien – das sind vor allem Menschen. Jedes andere Land wäre von so viel MENSCH und so viel sozialer Ungleichheit längst kollabiert. Obwohl dem Leben jedes Einzelnen bei einer Bevölkerungsanzahl von geschätzten 1,1 Milliarden nicht mehr die gleiche Bedeutung beigemessen werden kann, trotz grossem Hunger und bitterer Armut, kann eines nicht unter den Tisch gekehrt werden: Indien pulsiert, ja strotzt geradezu vor Leben, vor Energie! Die ungeheure Vielfalt an allem, was das Leben hergibt, macht die Faszination dieses Landes aus.
Mehr Phänomen denn Land
Doch eigentlich ist es vermessen, von «einem» Land zu sprechen. Indien beherbergt viele Länder in einem, jede Region hat wieder ihre eigenen Bräuche und Mythen, ihre ganz eigenen Gerichte, eine andere Art sich zu kleiden, andere Götter.... Indien ist viel weniger ein Land als ein Phänomen. Nur was taugt ein Phänomen schon als Ordnungsbegriff? Man kann sich bildhaft vorstellen, wie sich unsere Kartografen verzweifelt die ergrauten Haare raufen. Der Präsident der Kartografenvereinigung lässt eine dringliche Sonderkommission einberufen, die sich einzig und allein mit der Frage auseinandersetzen soll, wie sich das «Phänomen Indien» vernünftig kartografisch darstellen liesse. «Vielleicht mit Hilfe eines Symbols?», schlägt ein eher stiller Kartograf vor. «Gute Idee!», lobt der Vorsitzende der Kommission.
In Indien hat fast alles eine Symbolik. Das zinnoberrote Pulver, das sich verheiratete Frauen oberhalb der Stirn in den Haaransatz reiben, ist nur ein Bruchteil dessen, was die hinduistische Kultur an Symbolen zu bieten hat. Bei einer Geschäftseröffnung halten auch die modernsten Inder eine «Puja» ab; eine Anrufung der Götter, dass die Unternehmung einen erfolgreichen Verlaufen nehmen möge. Überhaupt Neuanfänge: Bei Geburten, Projektanfängen oder vor wichtigen Entscheidungen holt man sich im Tempel den Segen. An Geburtstagen trägt man neue Kleider, und sogar den Wochentagen ist eine Bedeutung zugeschrieben: Der Montag ist der Tag Shivas, der Dienstag «gehört» dem affenköpfigen Hanuman und so geht es weiter durch die ganze Woche. Wer auf besonderes Wohlwollen einer der Götter hofft, fastet am entsprechenden Tag oder isst zumindest kein Fleisch.
Die hinduistische Kultur versteht es wie keine zweite, dem Leben eine tiefere Bedeutung zu geben. Denn was sind Rituale und Symbole anderes als eine Möglichkeit, das Leben kostbar zu machen? Rituale hauchen dem Moment mehr Leben ein und damit mehr Sinnhaftigkeit.
Spiritualität und das Hamsterrad des Alltags liegen nirgends näher zusammen als in Indien, sie sind sosehr ineinander verflochten, dass niemand auf die Idee kommen würde, darin etwas Verwerfliches zu sehen. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Inder ihre Religion praktizieren und damit ihrem Bedürfnis nach Spiritualität Rechnung tragen, ist bemerkenswert. Ohne – und das muss an dieser Stelle besonders herausgehoben werden - im Geringsten ideologisch zu sein.
Alles im Fluss
Doch würde es Indien überhaupt kratzen, wenn es plötzlich zum Nabel der Welt erklärt würde? Wohl kaum. Indien würde es zur Kenntnis nehmen. Und damit hätte es sich. Indien und damit die Inder lassen sich nicht so schnell von irgendetwas beeindrucken. Diese Geisteshaltung ist bewundernswert, doch mit Gleichgültigkeit hat sie nichts zu tun. Manche sagen, sie entspringe einer extremen Form von Gottesgläubigkeit. Doch vielleicht rührt sie auch einfach von der Erfahrung her, dass sich im Minutentakt sowieso wieder alles ändern kann.
Die hinduistische Gesellschaft ist geprägt von einer ungeheuren Dynamik. Das lässt sich anhand eines einfachen Beispiels aus der Mobiltelefonindustrie verdeutlichen: Indien ist der am schnellsten wachsende Mobilfunkmarkt der Welt, bereits heute ist die 500-Millionen-Marke von Mobiltelefonnutzern erreicht und sollte bereits 2014 die Milliarden-Grenze sprengen. Für Länder wie Indien wurde das Mobiltelefon geradezu erfunden, weil es Raum lässt für Unvorhergesehenes. Auch die Schweizer oder die Deutschen loben sich sicherlich das tragbare Telefon. Doch genau genommen will es sich nämlich nicht so recht einfügen in unserer Kultur, da ein durchschnittlicher Angestellter an viel zu vielen Sitzungen teilnimmt, an denen er das Mobiltelefon dann trotzdem wieder ausschaltet. Inder sind ständig erreichbar. Rund um die Uhr. So etwas wie eine Combox existiert nicht. Warum auch, bis der Empfänger seine Nachrichten abgehört hat, ist die Botschaft bereits wieder veraltet. Alles im indischen Alltag geschieht immer aus dem Moment heraus.
Während es in Europa relativ verpönt ist, seine Pläne zu ändern, passiert das in Indien ständig. Was in Europa als Schwäche ausgelegt wird, bedarf in Indien nicht mal einer Entschuldigung. Das ist nicht Wankelmütigkeit, sondern Überlebensstrategie: Sich veränderten Lebensumständen anzupassen, kann in Indien unter Umständen überlebenswichtig sein. Nur wer stur an seinen Plänen festhält, gilt in Indien als schwach. Das macht die Inder auch zu formvollendeten Improvisationskünstlern. Selbst wenn im ersten Moment etwas unmöglich scheint, wird es irgendwie möglich gemacht. Ein kategorisches «nein» existiert nicht.
Eine knappe Mehrheit unter den Kartografen vertritt daher auch dezidiert die Meinung, dass Indien anstatt Amerika «das Land der unbegrenzten Möglichkeiten» sein sollte. Indien ist «artwork in process», ein Kunstwerk, das einem ständigen Wandel unterworfen ist.
India changes you
Bei dieser Ausgangslage erstaunt es wenig, dass Indien Menschen magisch anzieht, die sich neue Impulse für ihr Leben erhoffen. Die in ihren eigenen Mustern gefangen sind. Etwas abschätzig könnte man hier von Esoterikern und anderen Sinnsuchenden sprechen. Aber auch wer keine Berührungspunkte mit Spiritualität kennt, dem soll gesagt sein: Indien hat ein riesiges Potential für Veränderung. Oder um es mit den Worten der Soziologin Ursula Baumgardt auszudrücken: «Kontinuierlich bis zum heutigen Tag nimmt der Hinduismus Neues auf, d.h. er hat eine für uns kaum nachvollziehbare Kraft der Erneuerung.» Wer richtig eintaucht in diese «indiness», als Gast und nicht bloss als Besucher gegenwärtig ist, wird sich dem Sog der Veränderung unmöglich entziehen können. Indien schafft neue Räume im Innern, Gedanken gehen auf Wanderschaft und eingefahrene Denkprozesse werden gehörig auf den Kopf gestellt.
«Da muss was dran sein», räumt der Präsident der Kartografenvereinigung nachdenklich ein. Und er erhebt sich von seinem Platz, nimmt einen dicken Filzschreiber und zeichnet eine grosse Sonne auf das Flip-Chart. «Wie die Sonne hat auch Indien grosse Kraft zur Veränderung», setzt er an. «Deshalb soll Indien auf der Weltkarte in Zukunft mit einer Sonne dargestellt werden», bestimmt er. Denn: India changes you.
Eduschka - 2. Dez, 15:46
VERNISSAGE: 15. November im Restaurant ZUM GRÜNEN HUND in WINTERTHUR-Veltheim
Mit Lesung und Bilderausstellung!
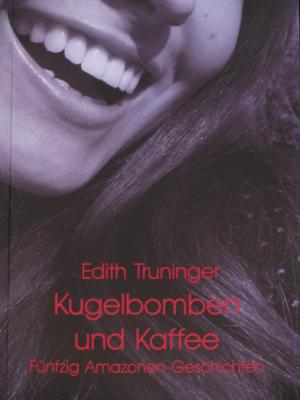
Kugelbomben und Kaffee, fünfzig Amazonen-Geschichten
108 Seiten, broschiert
Im Eigenverlag
Verkaufspreis 22.80 Franken
Inhalt:
Lockenkopf, die Eremitin, Kaktusblüte und die Römerin, genannt "die Amazonen": Das sind die besten Freundinnen der Journalistin und Autorin Edith Truninger. In diesem Kolumnenband nähert sie sich dem Leben der vier Charaktere, ihren Macken und jenen Eigenschaften, die sie unverwechselbar machen. Egal, ob es dabei um Liebe, Freundschaft oder Frausein geht, der Blick der Kolumnistin ist immer von zärtlicher Ironie geprägt.
Eduschka - 2. Nov, 12:31
Im Frühling war ich an eine Hochzeit eingeladen. Eine Schulfreundin von mir hat einen Mann aus Marokko geheiratet. Anlässlich einer kleinen Ansprache zu Tisch erzählte der Brautvater, dass sein Schwiegersohn, als sie einander vorgestellt wurden, gesagt habe, in Marokko sei er ein «Ladenhüter» gewesen – natürlich vom englischen Ausdruck «shopkeeper» abgeleitet. Wortwörtlich übersetzt ins Deutsche bekommt «Ladenhüter» natürlich einen ganz anderen Bedeutungsbeiklang: Ein «Ladenhüter» ist ein Kaufartikel, der niemand will, seine besten Zeiten bereits gesehen hat, Staub angesetzt hat. Mit dem Weissweinglas in der Hand habe ich leise in mich hineingelächelt und gedacht, dass wohl auch ich im Süsswarenladen der Liebe ein Ladenhüter bin.
Trotzdem weigere ich mich, mein Singlesein als Makel zu sehen. Gewisse Menschen scheinen ihr Single-Leben zu einem Martyrium hochzustilisieren, sie suhlen sich in der Opferrolle und setzen all ihre Energien dafür ein, diesem Zustand schnellstmöglich ein Ende zu setzen. Dieser Single-Uryp arbeitet meistens als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter in irgendeinem Büro, fährt in seiner Freizeit gerne Inlineskates und tritt bei «Züri Date» auf. «Und wie lange bist Du schon Single?», ist eine Frage, die nur er stellen kann. Ganz so als würden er jede Woche einen Strich an die Decke machen. Inventar des Defizits. Hinzu kommt dieser mitleidige Blick, der mehr nach «Und wie lange leidest Du schon an Herpes genitalis?» aussieht. Singlesein ist keine Krankheit, sondern bloss ein Hinweis darauf, wie die Verantwortungen in unserem Leben verteilt sind.
Denn Singlesein kann für eine gewisse Streckenetappe unseres Lebens auch selbst gewählt sein. Jeder möchte lieben, doch eine Beziehung heisst eben auch, Zugeständnisse zu machen. Die Ziele des anderen zu den eigenen werden lassen. Da ist es durchaus legitim, für sich selbst zu entscheiden, dass man für solche Opfer derzeit noch nicht bereit ist. Zu viel gibt es noch zu entdecken, zu viel zu experimentieren, zu viel einzusaugen vom Leben.
Warum ist es so wichtig zu wissen, ob jemand in einer Beziehung lebt, wenn es daneben so viele andere interessante Dinge über diese Person zu erfahren gibt? Die Liebe ist doch nur eine Facette unserer Persönlichkeit unter vielen. Vielleicht bin ich ein Ladenhüter, doch ich gefalle mir auch mit Staub auf dem Haar. Bevor ich die Freundin eines Mannes sein kann, möchte ich in erster Linie meine eigene Freundin sein. Weil die Beziehung zu einem Mann wahrscheinlich nur ein paar Jahre dauert. Die Beziehung zu mir selbst dagegen ist garantiert lebenslänglich.
Eduschka - 1. Nov, 20:50

Wir alle tragen Geschichten aus unserer Vergangenheit in uns, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Noch Jahre später geben wir sie mit vor Stolz geschwellter Brust zum Besten. Was wir gerne vergessen: Unser Blick ist voreingenommen, verschleiert vom Gefühl der Nostalgie. Für jemand, der nicht dabei gewesen ist, hat die Geschichte nicht die gleiche Sogwirkung. Unter den Amazonen heissen solche Geschichten «Coiffeur-Geschichten». Und das kam so:
Lockenkopf, Kaktusblüte und ich fahren im Auto, Lockenkopf sitzt am Steuer, als Kaktusblüte, scheinbar aus dem Nichts, von ihrem früheren Coiffeur Guido zu palavern beginnt. Jener Guido, der ihr als Mädchen die Haare geschnitten hat und ihr am Ende immer einen Lollipop in die Tasche steckte. Mit grösster Detailtreue zeichnet Kaktusblüte Leben und Biografie dieses Guido nach, inklusive der Tolle auf seinem Kopf und den Papagei im Salon.
Als Kaktusblüte ihren Monolog beendet hat, können weder Lockenklopf noch ich irgendeine Pointe darin erkennen. Eine verräterische Stille macht sich im Wagen breit, bis ich zu sagen wage: «Ähm... habe ich irgendwie die Pointe verpasst oder gibt es wirklich keine?» Wie sich herausstellt, war es ein unscheinbarer Salon am Strassenrand, der all diese wilden Assoziationen in Kaktusblüte ausgelöst hatte. Weder Lockenkopf noch ich hatten Guidos Salon überhaupt wahrgenommen.
Manchmal necken wir sie noch heute mit ihren Coiffeurgeschichten. Doch ob jemand einen Hang zu Coiffeurgeschichten hat, an den unmöglichsten Orten einschläft, vergesslich ist oder ständig in der Nase bohrt... genau solche kleinen Unzulänglichkeiten sind es doch, die unsere Freunde letztendlich so unverwechselbar machen.
Eduschka - 16. Sep, 19:18

Bridget Jones, die liebenswürdig-tapsige Katastrophen-Frau, die so gerne Tagebuch schreibt, hat den Begriff salonfähig gemacht: Liebestöter. Ein Liebestöter ist eine überdimensional grosse Unterhose, unmöglich in Schnitt und Farbe, die unter mysteriösen Umständen in die eigene Wäschekollektion geraten ist und darin eigentlich überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Sie fällt völlig aus dem Rahmen, tummelt sich munter und hässlich zwischen all den Cadillacs ihrer Sorte. Die Eremitin hat dafür auch den schönen Begriff „Gammler“ geprägt. Fast jede Frau hat irgendwo noch so einen vergammelten Liebestöter in ihrer Kommode, wenn sie nur tief genug in der Schublade gräbt.
Peinlich wird es erst dann, wenn unsere Liebestöter plötzlich Blicken ausgesetzt sind, die nie für sie bestimmt waren. Einmal geriet der Gammler einer Freundin in die Schmutzwäsche der Männer-WG ihres damaligen Freundes. Einen Vollwaschgang später sah sein Kumpel den Liebestöter in seiner ganzen Pracht an der Wäscheleine hängen und konnte sich einen abschätzig-ironischen Kommentar nicht verkneifen. Ihr Freund nahm das unappetitliche Textil seiner Freundin in Schutz, indem er sagte: „Das sind eben ihre 'Mensunterhosen'.
Unterhosen, die frau nur während ihrer Tage trägt? Woher er das wohl hatte? Die Amazonen waren sich für einmal alle einig: Auch wir wünschen uns einen Mann, der
unsere Liebestöter vor seinen Kumpels in Schutz nimmt und sogar dann noch schmeichelnde Worte für uns findet, wenn wir in dieselben gehüllt vor ihm stehen. Mut zur Hässlichkeit ist gefragt! Denn Liebestöter sind vor allem eins: der eindrückliche Beweis dafür, dass wir uns selbst nicht allzu wichtig nehmen. Bridget Jones würde mir beipflichten.
Eduschka - 18. Aug, 11:34

Manche Leute machen sich einen Spass daraus, uneingeladen an einer Party zu erscheinen und zuerst die Bar und dann danach das Kuchenbuffet zu plündern. Die Amazonen haben sich für diesen Sommer einen viel besseren Zeitvertreib ausgedacht. Das Spiel heisst: „Tu so, als ob du Polterabend feiern würdest“ oder „Fake the Polterabend“. Schliesslich gibt es keine Regel, die besagt, dass man kurz vor der Vermählung stehen muss um sich einen Rausch anzutrinken und sich ungebührlich zu benehmen. Die Amazonen schaffen das auch ganz ohne baldige Limousinenfahrt mit Schleppe und langem Kleid!
Und so verabreden sich die Eremtitin, Kaktusblüte und Lockenkopf mit ein paar Freundinnen zu einem gestellten „Polteri“. Wer sich als Braut der Lächerlichkeit preis geben muss, wird an Ort und Stelle per Los entschieden. Sich mitten in der Innenstadt mit bemalten T-Shirts zum Deppen zu machen, ist befreiend und für einmal bekommt man dafür sogar noch Geld. Treffen wir auf andere Poltergruppen – an diesem Abend sehr zahlreich vorhanden – entsteht sogleich ein erhebendes Solidaritätsgefühl. Die unechte Braut spielt wunderbar mit und schwärmt in den buntesten Farben von ihrem Verlobten namens Massimo... der genauso unecht ist wie die Braut selbst.
Als wir gerade in einer Bar abtanzen, trifft Lockenkopf auf eine Schulfreundin aus früheren Tagen. Sie heiratet bald und hält in der gleichen Bar ihren Polterabend ab wie wir - einen echten, versteht sich. „Wer heiratet bei euch, etwa du?“, will sie wissen, woraufhin Lockenkopf ein bisschen zu schnell und zu vehement den Kopf schüttelt. Allein ihrem Losglück ist es zu verdanken, dass Lockenkopf der echten Braut nicht im Nachthemd und mit orangen Schwimmflügeli am Oberarm irgendwie glaubhaft machen musste, dass es im Moment zugegebenermassen ein bisschen danach aussehe, sie aber dennoch nicht vor habe zu heiraten...
Eduschka - 6. Aug, 08:42

Nirgendwo sonst im Alltag unterscheiden sich die Geschlechter so stark in ihrem Verhalten wie beim Telefonieren. Wenn Männer mit Männern telefonieren, besteht dieses Telefonat aus einem kurzen Wortwechsel, gefolgt von einem abrupten „ciao“.Maximale Gesprächsdauer: 3 Minuten. Ich denke an die Telefongespräche mit meinen Geschlechtsgenossinnen und stelle fest: Der Unterschied könnte grösser nicht sein.
Ein Telefongespräch unter Frauen dauert, und hier sprechen wir noch nicht von der Verabschiedung. Denn eine Verabschiedung unter Freundinnen ist keine blosse Verabschiedung, sondern ein Ritual. Ein Ritus, das durchaus monumentale Ausmasse annehmen kann. Da heisst es dann: «Also, okay, tschau, tschüss, mach’s gut…», und dann lässt sich Gesprächspartnerin Nummer eins nochmals zu einer Bemerkung hinreissen und ab geht’s in die nächste Runde, die wieder endet mit «also, okay, tschau, tschüss, mach’s gut, woraufhin Gesprächspartnerin zwei der letzte, aber dieses Mal ist es wirklich der letzte, Einschub einfällt… Eine Unsitte! Und noch dazu genetisch bedingt, versuchen die Eremitin und ich doch immer wieder, den langen Weg der Verabschiedung zu verkürzen – und scheitern kläglich.
Doch es gibt eine Erklärung dafür. Für Frauen bedeutet eine Verabschiedung immer gleich eine Art Trennung, die sie mit möglichst viel Zuwendung kompensieren müssen. Sehr wortreich möchten sie einander auf dem berühmten Beziehungsohr versichern, dass dieser Abschied nur eine Beendigung des Gesprächs ist und nicht etwa das Ende ihrer Freundschaft… kompliziert, würden Männer sagen.
Entsprechend schwierig gestaltet sich der geschlechterübergreifende Versuch eines Telefonats. Lockenkopf beschwert sich regelmässig darüber, dass ihr Freund immer so monoton redet am Telefon. „Zeig doch ein bisschen Emotionen!“, ruft sie dann aus. Und wehe, der Angebetete hinterlässt eine monotone Nachricht für sie auf dem Telefonbeantworter! Da muss er mit Sanktionen rechnen. Die Römerin hat ebenfalls resigniert, was Männer und das Telefonieren anbelangt, ihr trockener Kommentar: „Wir können nicht miteinander telefonieren.“ Hätte es im Paradies schon ein Telefon gegeben, die Menschheit wäre wohl längst ausgestorben.
Vielleicht sind nie enden wollende Telefongespräche so etwas wie die Essenz jeder richtig guten Frauenfreundschaft. Da kommt es auf die zehn bis fünfzehn Minuten, die so ein Abschiedsritual locker in Anspruch nimmt, doch wirklich nicht mehr an.
Eduschka - 21. Jul, 18:23
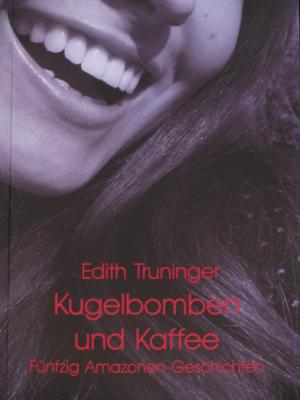
 Wir alle tragen Geschichten aus unserer Vergangenheit in uns, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Noch Jahre später geben wir sie mit vor Stolz geschwellter Brust zum Besten. Was wir gerne vergessen: Unser Blick ist voreingenommen, verschleiert vom Gefühl der Nostalgie. Für jemand, der nicht dabei gewesen ist, hat die Geschichte nicht die gleiche Sogwirkung. Unter den Amazonen heissen solche Geschichten «Coiffeur-Geschichten». Und das kam so:
Wir alle tragen Geschichten aus unserer Vergangenheit in uns, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Noch Jahre später geben wir sie mit vor Stolz geschwellter Brust zum Besten. Was wir gerne vergessen: Unser Blick ist voreingenommen, verschleiert vom Gefühl der Nostalgie. Für jemand, der nicht dabei gewesen ist, hat die Geschichte nicht die gleiche Sogwirkung. Unter den Amazonen heissen solche Geschichten «Coiffeur-Geschichten». Und das kam so:  Bridget Jones, die liebenswürdig-tapsige Katastrophen-Frau, die so gerne Tagebuch schreibt, hat den Begriff salonfähig gemacht: Liebestöter. Ein Liebestöter ist eine überdimensional grosse Unterhose, unmöglich in Schnitt und Farbe, die unter mysteriösen Umständen in die eigene Wäschekollektion geraten ist und darin eigentlich überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Sie fällt völlig aus dem Rahmen, tummelt sich munter und hässlich zwischen all den Cadillacs ihrer Sorte. Die Eremitin hat dafür auch den schönen Begriff „Gammler“ geprägt. Fast jede Frau hat irgendwo noch so einen vergammelten Liebestöter in ihrer Kommode, wenn sie nur tief genug in der Schublade gräbt.
Bridget Jones, die liebenswürdig-tapsige Katastrophen-Frau, die so gerne Tagebuch schreibt, hat den Begriff salonfähig gemacht: Liebestöter. Ein Liebestöter ist eine überdimensional grosse Unterhose, unmöglich in Schnitt und Farbe, die unter mysteriösen Umständen in die eigene Wäschekollektion geraten ist und darin eigentlich überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Sie fällt völlig aus dem Rahmen, tummelt sich munter und hässlich zwischen all den Cadillacs ihrer Sorte. Die Eremitin hat dafür auch den schönen Begriff „Gammler“ geprägt. Fast jede Frau hat irgendwo noch so einen vergammelten Liebestöter in ihrer Kommode, wenn sie nur tief genug in der Schublade gräbt.  Manche Leute machen sich einen Spass daraus, uneingeladen an einer Party zu erscheinen und zuerst die Bar und dann danach das Kuchenbuffet zu plündern. Die Amazonen haben sich für diesen Sommer einen viel besseren Zeitvertreib ausgedacht. Das Spiel heisst: „Tu so, als ob du Polterabend feiern würdest“ oder „Fake the Polterabend“. Schliesslich gibt es keine Regel, die besagt, dass man kurz vor der Vermählung stehen muss um sich einen Rausch anzutrinken und sich ungebührlich zu benehmen. Die Amazonen schaffen das auch ganz ohne baldige Limousinenfahrt mit Schleppe und langem Kleid!
Manche Leute machen sich einen Spass daraus, uneingeladen an einer Party zu erscheinen und zuerst die Bar und dann danach das Kuchenbuffet zu plündern. Die Amazonen haben sich für diesen Sommer einen viel besseren Zeitvertreib ausgedacht. Das Spiel heisst: „Tu so, als ob du Polterabend feiern würdest“ oder „Fake the Polterabend“. Schliesslich gibt es keine Regel, die besagt, dass man kurz vor der Vermählung stehen muss um sich einen Rausch anzutrinken und sich ungebührlich zu benehmen. Die Amazonen schaffen das auch ganz ohne baldige Limousinenfahrt mit Schleppe und langem Kleid! Nirgendwo sonst im Alltag unterscheiden sich die Geschlechter so stark in ihrem Verhalten wie beim Telefonieren. Wenn Männer mit Männern telefonieren, besteht dieses Telefonat aus einem kurzen Wortwechsel, gefolgt von einem abrupten „ciao“.Maximale Gesprächsdauer: 3 Minuten. Ich denke an die Telefongespräche mit meinen Geschlechtsgenossinnen und stelle fest: Der Unterschied könnte grösser nicht sein.
Nirgendwo sonst im Alltag unterscheiden sich die Geschlechter so stark in ihrem Verhalten wie beim Telefonieren. Wenn Männer mit Männern telefonieren, besteht dieses Telefonat aus einem kurzen Wortwechsel, gefolgt von einem abrupten „ciao“.Maximale Gesprächsdauer: 3 Minuten. Ich denke an die Telefongespräche mit meinen Geschlechtsgenossinnen und stelle fest: Der Unterschied könnte grösser nicht sein.